Zweiweg-Gleichrichter Rechner
Berechnung von Brückengleichrichtern: Effektivspannung, Mittelspannung und Spannungsverluste
Geben Sie die Eingangsspannung (Effektiv- oder Spitzenspannung) und die Gesamtdiodenspannung ein und klicken Sie auf Berechnen um die Ausgangsspannungen des Brückengleichrichters zu ermitteln.
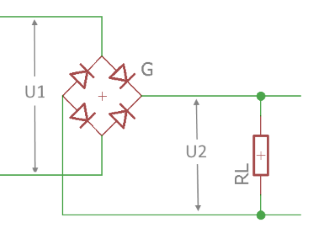
Zweiweg-Gleichrichter (Brückengleichrichter) verstehen
Der Brückengleichrichter ist die gebräuchlichste und effizienteste Art der Gleichrichtung. Er verwendet vier Dioden in Brückenschaltung und nutzt beide Halbwellen der Eingangsspannung. Die negativen Halbwellen werden durch das zweite Diodenpaar "umgeklappt", wodurch eine pulsierende Gleichspannung mit geringer Welligkeit entsteht.
🌉 Brückenprinzip
Vollwellengleichrichtung:
📊 Spannungswerte
Hohe Effizienz:
✅ Vorteile
- • Geringste Welligkeit (38% vs. 121%)
- • Beste Transformator-Ausnutzung
- • Hohe Ausgangsspannung
- • Keine Mittelpunkt-Anzapfung nötig
❌ Nachteile
- • Vier Dioden erforderlich (höhere Kosten)
- • Doppelter Spannungsabfall (2×UD)
- • Etwas komplexerer Aufbau
- • Höhere Verluste bei niedrigen Spannungen
Grundformeln der Brückengleichrichtung
⚡ Spannungsbeziehungen
Ausgangsspannung und Verluste:
\[U_{2s} = U_{1s} - 2 \times U_D\] \[U_{1s} = U_{1eff} \cdot \sqrt{2} \text{ (Spitzenspannung)}\] \[2 \times U_D = 1,4 \text{ V (zwei Si-Dioden)}\]
U₂s: Spitzenspannung nach den Dioden
📊 Mittelwert und Effektivwert
Berechnung der Ausgangsspannungen:
\[U_{mittel} = \frac{2 \times U_{2s}}{\pi} \approx 0,636 \times U_{2s}\] \[U_{eff} = \frac{U_{2s}}{\sqrt{2}} \approx 0,707 \times U_{2s}\] \[\text{Formfaktor: } \frac{U_{eff}}{U_{mittel}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx 1,11\]
🌊 Welligkeit und Ripple
Kennwerte der pulsierenden Gleichspannung:
\[\text{Welligkeit: } r = \frac{U_{wechsel}}{U_{mittel}} = \sqrt{\left(\frac{U_{eff}}{U_{mittel}}\right)^2 - 1}\] \[r = \sqrt{1,11^2 - 1} \approx 0,38 = 38\%\] \[\text{Grundfrequenz: } f_{ripple} = 2 \times f_{netz}\]
Signalverläufe
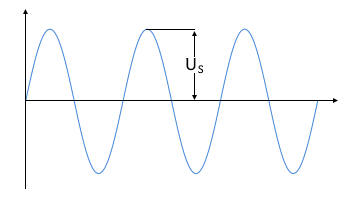
Eingangsspannung US
Sinusförmige Wechselspannung
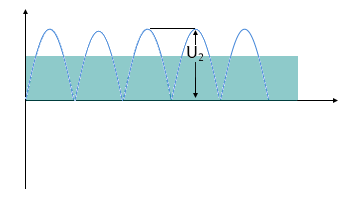
Ausgangsspannung U₂
Beide Halbwellen, pulsierende Gleichspannung
Praktische Beispiele
📝 Beispiel 1: 24V-Netzteil
Aufgabe: Standard 24V-Netzteil mit Brückengleichrichtung
Gegeben: Ueff = 18 V (Sekundärspannung), 2×UD = 1,4 V
Berechnung:
\[U_{1s} = 18 \cdot \sqrt{2} = 25,5 \text{ V}\] \[U_{2s} = 25,5 - 1,4 = 24,1 \text{ V}\] \[U_{mittel} = \frac{2 \times 24,1}{\pi} = 15,3 \text{ V}\] \[U_{eff} = \frac{24,1}{\sqrt{2}} = 17,0 \text{ V}\]
Ergebnis: Ausgangsspannung 15,3 V DC mit 38% Welligkeit (deutlich besser als Einweg).
📝 Beispiel 2: Labornetzteil 30V
Aufgabe: Regelbares Labornetzteil mit Brückengleichrichter
Gegeben: Ueff = 24 V, 2×UD = 1,4 V (Schottky: 1,0 V)
Berechnung:
\[U_{1s} = 24 \cdot \sqrt{2} = 33,9 \text{ V}\] \[\text{Si-Dioden: } U_{2s} = 33,9 - 1,4 = 32,5 \text{ V}\] \[\text{Schottky: } U_{2s} = 33,9 - 1,0 = 32,9 \text{ V}\] \[U_{mittel} = \frac{2 \times 32,5}{\pi} = 20,7 \text{ V}\]
Ergebnis: Schottky-Dioden erhöhen Ausgangsspannung um 0,4V (weniger Verluste).
Vergleich mit anderen Gleichrichtern
🏆 Brückengleichrichter
- • Welligkeit: 38% (beste)
- • Frequenz: 2×fnetz (100Hz)
- • Effizienz: Hoch (beide Halbwellen)
- • Transformator: Optimal genutzt
❌ Einweggleichrichter
- • Welligkeit: 121% (schlechte)
- • Frequenz: 1×fnetz (50Hz)
- • Effizienz: Niedrig (nur positive HW)
- • Transformator: Schlecht genutzt
Praktische Anwendungen
🏭 Industrielle Netzteile
- • Standard-Schaltnetzteile
- • Laborversorgungen
- • Schweißgeräte
- • Motor-Antriebe (DC)
💡 Verbraucher-Elektronik
- • PC-Netzteile (Vorstufe)
- • Audio-Verstärker
- • LED-Treiber (Hochleistung)
- • Batterieladegeräte
⚡ Hochleistungsanwendungen
- • USV-Anlagen
- • Elektrolyse-Gleichrichter
- • Galvanik-Anlagen
- • Traktions-Gleichrichter
🔬 Labor und Prüftechnik
- • Regelbare DC-Quellen
- • Konstantstrom-Quellen
- • Elektronische Lasten
- • Präzisions-Messgeräte
💡 Praktische Tipps:
- Diodenauswahl: Fast-Recovery-Dioden für Schaltnetzteile
- Schottky-Dioden: Bei niedrigen Spannungen wegen geringerem Spannungsabfall
- Dimensionierung: Dioden müssen Spitzenspannung und Strom aushalten
- Kühlung: Bei hohen Strömen ausreichende Wärmeableitung vorsehen
🏆 Warum Brückengleichrichter Standard sind:
- Beste Effizienz: Beide Halbwellen werden genutzt
- Geringste Welligkeit: Nur 38% statt 121% (Einweg)
- Hohe Ausgangsspannung: Fast volle Eingangsspannung
- Universell einsetzbar: Von mW bis MW-Bereich
Grundlagen
Leitungswiderstand
kVA aus Ampere und Volt
Dezibel in linearen Faktor umrechnen
Dezibel, Spannung, Leistung umrechnen
Ohmsche Gesetz
Coulombsche Gesetz
Batterie Kapazität
Elektrizitätsmenge
Elektrische Energie
Elektrische Leistung
Elektrische Ladung
Innenwiderstand einer Stromquelle
Kondensator Kapazität
Spannungverlust auf einer Leitung
Tabelle der Temperaturkoeffizienten
Temperaturabhängigkeit vom Widerstand
Schaltungen mit Widerständen
PI-Dämpfungsglied
T-Dämpfungsglied
2 Parallelwiderstände
Mehrere Parallelwiderstände
Serienwiderstände
unbelasteter Spannungsteiler
belasteter Spannungsteiler
Vorwiderstand (Voltmeter)
Parallelwiderstand (Ampermeter)
Schaltungen mit Kondensatoren
Mehrere Kondensatoren Reihenschaltung
Zwei Kondensatoren Reihenschaltung
Blindwiderstand XC eines Kondensators
Zeitkonstante eines R/C-Glieds
Ladespannung zu einem Zeitpunkt
Kondensatorspannung zu einem Zeitpunkt
R oder C zu einer Ladespannung
RC Reihenschaltung
RC Parallelschaltung
RC Hochpass
RC Tiefpass
RC Differenzierer
RC Integrierierer
RC Grenzfrequenz berechnen
R + C bei gegebener Impedanz
Schaltungen mit Spulen
Induktivität einer Spule
Blindwiderstand einer Spule
L/R Reihenschaltung
L/R Parallelschaltung
L/R Hochpass
L/R Tiefpass
L/R Grenzfrequenz
L/R Differenzierglied
Transformator
Kondensatoren und Spulen
Resonanzfrequenz
Serienschwingkreis
Parallelschwingkreis
Parallelschaltung
Serienschaltung
Gleichrichter- und Dioden
Einweg Gleichrichtung
Einweg Gleichrichtung mit Ladekondensator
Zweiweg Gleichrichtung
Zweiweg Gleichrichtung mit Ladekondensator
LED Vorwiderstand
Vorwiderstand zur Zenerdiode mit variabler Last
Vorwiderstand zur Zenerdiode